Anlässlich der Anfang Oktober in Braunschweig stattfindenden 64. Deutschen Pflanzenschutztagung melden sich die Agrarwissenschaftler Horst-Henning Steinmann und Bärbel Gerowitt von den Universitäten Göttingen und Rostock zu Wort. Sie appellieren, die Wechselwirkungen von Pflanzenschutz und Biodiversität weiterhin im Blick zu behalten. Vieles, was in den vergangenen Jahrzehnten an Bewusstsein und an Aktivitäten zum Schutz der Biologischen Vielfalt aufgebaut wurde, gerät sonst in Gefahr, wieder zunichte gemacht zu werden.
Pflanzenschutz und Biodiversität: Wir waren schon mal weiter
Horst-Henning Steinmann, Bärbel Gerowitt
Mit diesem Text melden wir uns als Phytomediziner zu Wort, die sich langjährig mit Praktiken des integrierten Pflanzenschutzes, der Weiterentwicklung von Ackerbausystemen und der Erforschung von Interaktionen zwischen Pflanzenschutz und Agrarökosystem beschäftigt haben. Uns beunruhigt der Verlauf der Diskussion über den Zustand der Biodiversität und die Rolle, die der Pflanzenschutz dabei spielt. Wir sehen, dass diese Diskussion in Teilen von Missverständnissen geprägt ist und dass unsere Branche Gefahr läuft, sich von Erkenntnissen abzukoppeln, die wir eigentlich besser kennen. Dies umso mehr, als viele dieser Erkenntnisse in unserem Kreis gewonnen wurden und werden.
Worum geht es?
Pflanzenschutz ist von je her ein wichtiges Instrument bei der Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln. Pflanzenschutz besteht nicht nur aus der Anwendung chemischer Mittel. Auch mechanische, biologische Verfahren oder Maßnahmen der Anbauplanung der Kulturpflanzen werden dazu gerechnet. Der chemische Pflanzenschutz wird häufig separat betrachtet, weil diese Technologie vorrangig auf der Verwendung von synthetischen Substanzen beruht. Auch hier soll es überwiegend um den chemischen Pflanzenschutz gehen, wenn von Pflanzenschutz die Rede ist.
Für eine lange Zeit war der Blick auf den Pflanzenschutz durchweg positiv. Bekämpfungserfolge bei gefürchteten Schaderregern halfen dabei, Ernteerträge zu sichern und Missernten zu vermeiden. Das Wissen um Nebenwirkungen der Präparate war gering. Der Umgang mit diesen Nebenwirkungen war nur von geringem Risikobewusstsein geprägt. Seit einigen Jahrzehnten hat sich dieser Blick gewandelt. Erkenntnisse haben sich durchgesetzt, dass von Pflanzenschutzmitteln eine Fülle von Nebenwirkungen ausgehen können. Kritische Sichtweisen auf den Pflanzenschutz haben zugenommen und überwiegen mittlerweile in der öffentlichen Diskussion. Manche dieser kritischen Stimmen mögen (zu) harsch vorgetragen sein. Manche erscheinen uns aber durchaus berechtigt, zumal sich auch viele Agrarwissenschaftler an einem kritischen und reflektierenden Austausch beteiligen.
Zu den Nebenwirkungen des Pflanzenschutzes gehören unter anderem auch Effekte auf Nicht-Ziel-Organismen. Es bei der Entwicklung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln kaum möglich einerseits eine spezifische Wirkung auf Schaderreger zu erzielen – zum Beispiel mit Insektiziden – und andererseits andere, oftmals nahe verwandte Organismen gänzlich unbehelligt zu lassen. Ein Restrisiko lässt sich kaum vermeiden. Beim Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln wird daher versucht, mittels Risikominderungsmaßnahmen und Anwendungsauflagen einen Kompromiss zwischen Wirksamkeit (dem agronomischen Nutzen) und dem Restrisiko (dem ökologischen Schaden) zu finden.
Der Begriff der Nicht-Ziel-Organismen ist den Beteiligten im Pflanzenschutz, sei es in Entwicklung, Zulassung oder Anwendung, aufgrund dieser langjährigen Praxis sehr geläufig. Weniger vertraut war man zunächst mit dem Begriff der Biologischen Vielfalt (oder gleichbedeutend auch Biodiversität). Dieser Begriff stammt aus den ökologischen Disziplinen und hat sich seit den 1980er Jahren in Wissenschaft und Öffentlichkeit weitgehend durchgesetzt. Beides, Nicht-Ziel-Organismen und Biodiversität sind nicht identisch, aber auch nicht vollständig voneinander zu trennen, weil sie zur gleichen Organismengrundgesamtheit gehören. Pflanzenschutz und Biodiversität haben deshalb immer etwas miteinander zu tun; aufgrund der potenziellen und tatsächlichen Nebenwirkungen bleiben aber Konflikte nicht aus.
”Der Zustand der Biodiversität ist gekennzeichnet durch einen seit Jahrzehnten beobachtenden Rückgang von Arten und Individuenzahlen sowie deren typischer Lebensgemeinschaften. Dies gilt sowohl für Pflanzen als auch für Tiere der Agrarlandschaft. Dies ist der Teil der Umwelt, in dem wir mit der Landwirtschaft unmittelbar tätig sind. Eine Fülle von Studienergebnissen und Publikationen liegt vor, die diesen Rückgang beschreiben und vielfach auch quantifizieren[i].
Horst-Henning Steinmann und Bärbel GerowittAutor und Autorin
Es muss angesichts dieser Befundlage überraschen, wenn aus unserer Branche diese Ergebnisse angezweifelt werden. Manchmal heißt es, diese Studien hätten aufgrund ihres experimentellen Designs oder ihrer statistischen Methoden nur begrenzte oder gar keine Aussagekraft. Mitunter werden Studien – und manchmal auch gleich mitsamt der Autorinnen und Autoren – insgesamt diskreditiert. Hier seien Menschen am Werk, die eher von Gesinnung als von Erkenntnisdrang geleitet seien, heißt es dann. Dieser Vorwurf wird besonders dann erhoben, wenn landwirtschaftliche Praktiken als Ursachen für den Biodiversitätsverlust diskutiert werden. Manchmal hören wir, Maßnahmen, die in der Landschaft zur Verbesserung und zum Schutz der Biologischen Vielfalt beitragen, seien noch gar nicht in ihrer Wirksamkeit belegbar. Das müsse alles erst einmal ganz genau untersucht werden.
Wir appellieren dringend an unsere Fachkolleginnen und -kollegen, sich diese Lesart nicht leichtfertig zu eigen zu machen. Es trifft sicher zu, dass manche Trendaussagen uneinheitliche Muster ergeben, manche Versuchsdesigns und Auswertungsmodelle nicht zu unseren gewohnten Methoden passen und dass manche Argumentationen in agrarischen Details nicht immer sachkundig sein mögen. Eine solche diverse Befund- und Quellenlage ist aber in einer wissenschaftlichen Diskussion gar nicht unüblich. Im wissenschaftlichen Austausch, wie z.B. in den Fachgruppen der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft kennen und leben wir den argumentativen Streit bei der Interpretation unserer Ergebnisse. Dennoch würden wir wohl kaum einer dieser Fachgruppen die wissenschaftliche Existenzberechtigung komplett absprechen. Bei aller Verschiedenheit der methodischen Ansätze und Deutungskonzepte agrarökologischer Studien sollten wir den grundsätzlichen Trend in der Biodiversität nicht leugnen.
Ist wirklich alles noch so unklar?
Hin und wieder ist von einzelnen Studien und Ergebnissen die Rede, die einen Rückgangstrend nicht belegen oder gar eine Verbesserung des Zustandes ablesen lassen. Warum sollte bei der Vielzahl von Ergebnissen nicht auch solches beobachtet werden? Insgesamt sind die Zahl und der Anteil derartiger Befunde aber gering. Gewarnt werden muss vor vorschnellen manchmal unrichtigen Interpretationen von Studien oder vor dem Argumentieren mit anekdotischen unveröffentlichten Felderhebungen mit unklarer Daten- und Methodentransparenz. Gerade wenn wir aus der Pflanzenschutzcommunity anderen Disziplinen oder der Öffentlichkeit Nachlässigkeiten vorhalten, dürfen wir selber uns nicht auf argumentativ dünnes Eis begeben.
Fast schon einen Klassikerstatus im Hinblick auf Überfrachtung mit Interpretationen hat die sogenannte Krefeld-Studie erreicht[ii]. Der dort beschriebene Rückgang von Populationen von Fluginsekten wurde in der Öffentlichkeit stark wahrgenommen, debattiert und auch die Verantwortung der Landwirtschaft an diesen Befunden wurde diskutiert, obwohl ein solcher Zusammenhang aus der rein deskriptiven Studie gar nicht hervorgeht. Im Gegenzug wurde die Publikation aus unseren Reihen mit Methodenkritik überzogen und sogar der Rückgangstrend wurde bestritten, obwohl auch andere Studien derartige Trends zeigen[iii].
Als einige Jahre später eine weitere Studie erschien, in der die Krefelder Daten auf der Suche nach möglichen erklärenden Variablen erneut ausgewertet wurden, fanden sich die Kritiker bestätigt. Die neue Untersuchung hatte gezeigt, dass Klimavariablen – also Effekte des Klimawandels – den größten Beitrag zur Erklärung des beschriebenen Insektenrückganges liefern[iv]. In der Agrar- und Pflanzenschutzbranche wurde diese neue Erklärung der Krefelder Daten sehr aufmerksam wahrgenommen und in die eigene Argumentation integriert. Wenn der Einfluss des Klimas für den Verlauf der Insektenpopulationen verantwortlich sei, dann könne folglich die Verantwortung nicht mehr beim Pflanzenschutz liegen, wird argumentiert. Wenig bis kaum beachtet wurde dabei die Schlussfolgerung der Autoren, dass angesichts dieser drastischen Folgen des Klimawandels die Lebensraumqualität der Landschaften für die Insekten nicht noch weiter strapaziert werden solle. Eine Entwarnung geht aus der Neuberechnung ebenso wenig hervor wie die Annahme, dass in der originalen Krefeld-Studie falsch gerechnet worden sei.
Es wird also schwierig, wenn bei der Suche nach den Ursachen des Biodiversitätsrückganges der Pflanzenschutz diskutiert wird. Agrarökologische Erkenntnisse entstehen oft in großflächigen Versuchsdesigns, in Monitorings oder durch Auswertung von komplexen Daten – nicht nur in exakt zu planenden Versuchen im Labor- oder Kleinparzellenmaßstab. Die Befunde hinsichtlich der Wirkungsstärke einzelner Ursachen aufzuschlüsseln, ist deshalb meist mit einem „Unsicherheitsrauschen“ behaftet, aber sie sind deswegen nicht per se weniger valide. Sich damit informiert auseinanderzusetzen, sollte auch für Pflanzenschützer zum wissenschaftlichen Alltag gehören.
Manche Ursachen des Biodiversitätsverlustes sind dennoch offenkundig: Die Fragmentierung der Landschaft, der Verlust von Nahrung und Habitaten und die Intensivierung bzw. Vereinheitlichung der Bewirtschaftung, um nur einige zu nennen. Viele Faktoren wirken dabei miteinander und verstärken sich gegenseitig. Auch der Pflanzenschutz ist immer daran beteiligt.
Eine mit breiter Expertise zusammengesetzte Arbeitsgruppe hat 2020 im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz eine Auswertung vorgenommen, um den Beitrag des Pflanzenschutzes am aktuellen Zustand der Biodiversität herauszuarbeiten[v]. Umfangreiche Literatur wurde dazu ausgewertet. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Anteil des Pflanzenschutzes, wie auch der Anteil anderer Faktoren, nicht exakt bestimmt werden kann. Zu sehr und zu komplex sind die Interaktionen im Agrarökosystem ineinander verflochten. Hingewiesen wurde jedoch darauf, dass in einer Anzahl von Studien der Pflanzenschutz konkret als nachteilig für die Biodiversität beschrieben wurde[vi].
Es kann festgehalten werden: Ein Rückgang der Biologischen Vielfalt ist vielfach dokumentiert. Pflanzenschutz hat eine beeinträchtigende Wirkung auf die Biologische Vielfalt. Wir wissen nur nicht genau wieviel Prozent er insgesamt zum Rückgang beiträgt. Weil dies so ist, verbietet sich aber die Schlussfolgerung, der Anteil des Pflanzenschutzes an diesem Rückgang sei nur untergeordnet. Denn auch das kann angesichts der geschilderten Unsicherheit so nicht genau festgestellt werden.
Müssten wir es besser wissen?
Warum tun wir uns in Teilen unserer Fachgesellschaft so schwer, diese Zusammenhänge anzuerkennen und aufzugreifen? Die Selbstregulation von Agrarsystemen zu stärken, um die Fremdregulation mit Pflanzenschutzmitteln zu minimieren, ist ein Fundament des integrierten Pflanzenschutzes. Uns macht es ratlos, dass wir in der Diskussion über den Umgang mit der Biologischen Vielfalt aktuell so oft hinter einen Erkenntnisstand zurückfallen, den wir vor 30, 40 Jahren schon mal erreicht hatten. Wir waren schon mal weiter.
Wir möchten daran erinnern, dass bereits in den 1980er und 1990er Jahren deutschlandweit in zahlreichen Arbeitsgruppen unserer Disziplin intensiv zu den Interaktionen von Pflanzenschutz, den Anbauverfahren der Pflanzenproduktion sowie der Landschaftsstruktur gearbeitet wurde. Wichtige Erkenntnisse über die Nebenwirkungen von Anbaumethoden aber auch zur Wirkung von Fördermaßnahmen auf die Biodiversität (der Begriff setzte sich erst später durch) wurden zu dieser Zeit gewonnen. Es ist nicht fair und zeugt nicht von guter Informiertheit, wenn diese Arbeits- und Lebensleistungen unserer Kolleginnen und Kollegen übersehen werden.
Aber es geht nicht nur um wissenschaftshistorische Befindlichkeiten. Viele Landwirte haben die Herausforderung angenommen, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen – auch um die Biodiversität zu schonen. Weiterhin ist es ärgerlich, wenn mit dem Bestreiten der Erkenntnisse auch die vielfältigen Initiativen aus der Praxis ausgebremst werden, die in den letzten Jahrzehnten langsam angelaufen sind und mittlerweile ein buntes Bild in der Landschaft ergeben. Es hat eine Weile gebraucht, aber die seit den 1990er Jahren angeschobenen Umweltprogramme sind mittlerweile in den Betrieben angekommen. Viele Menschen in der Landwirtschaft haben sich dem Gedanken geöffnet, die Lebensraumqualität der Agrarlandschaft in kleinen Schritten zu verbessern. Blühstreifen, Lerchenfenster, Beetle Banks und wie die Maßnahmen alle heißen mögen, gehören mittlerweile immer mehr zum Betriebsablauf dazu. Immer wieder berichten die landwirtschaftlichen Wochenblätter über Vereine oder Gruppen, die sich in den Regionen dem Erhalt der Vielfalt verschrieben haben, oft auch ohne staatliche Förderung. Teils aus echter Überzeugung, teils aus dem Wunsch der Imagepflege und als Gesprächsangebot mögen diese Aktivitäten entstanden sein. Das sind alles wertvolle und anerkennenswerte Beiträge. Diesen Menschen und ihren Initiativen wird der Schwung genommen, wenn wir das wissenschaftliche Fundament für ihr Tun diskreditieren. Ein großer Schaden wird auf diese Weise angerichtet.
”Als Agrarwissenschaftler mit Praxisbezug wissen wir um den Bedarf nach Nahrungs- und Futtermitteln und die wichtige Leistung des Pflanzenschutzes für die Sicherheit der Ernten. Die Agrarlandschaft ist auch ein Produktionsstandort und nicht nur eine Arena für Käfer. Aber wir nehmen auch wahr, dass der Pflanzenschutz aus sich selbst heraus an Grenzen stößt, die die Stabilität der Agrarproduktion begrenzen.
Horst-Henning Steinmann und Bärbel GerowittAutor und Autorin
Der Pflanzenschutz in den Agrarsystemen ist in einer Innovationskrise. Zum Beispiel entwickeln immer mehr Schadorganismen Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe, deren Wirkung entsprechend nachlässt. Diese Entwicklung ist nicht neu, sondern hat bereits vor ca. 50 Jahren und global eingesetzt. Es ist eine Reaktion des Agrarökosystems gegen wiederholte, gleichgerichtete Bekämpfungen, die letztendlich jeden Wirkstoff treffen kann. Dass dieses Phänomen allein auf die jüngst rückläufige Zulassung von Wirkstoffen zurückgeht, ist deshalb zweifelhaft. Natürlich ist es wünschenswert, Pflanzenschutzmittelwirkstoffe gegen neu aufkommende und Verlust bringende Schaderreger zur Verfügung zu haben. Deshalb fordern Pflanzenschützer, die Zulassungsverfahren neu zu justieren. Dafür ist es aber unabdingbar, die Stabilität der Agrarsysteme zunächst soweit wie möglich ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu stärken. Erst dann ist es zu verantworten, Lockerungen des Regelwerks bei den Mittelzulassungen anzustoßen. Lediglich das Produktportfolio auszuweiten, würde nur kurzfristig alte Muster bedienen, die Resistenzlage bei den Schaderregern aber langfristig nicht verbessern. Dringend benötigte Innovationen auf der Basis resilienterer Agrarsysteme anzugehen, ist klüger für alle Seiten.
Es ist uns bewusst, dass eine oft harsche Kritik aus der Öffentlichkeit und den Medien an der Agrarpraxis im Allgemeinen und am Pflanzenschutz im Besonderen mitunter den Pfad der Sachlichkeit und der Sachkunde verlässt. Auch wir kennen genug Beispiele plakativer oder schlecht recherchierter Berichte. Dennoch sind wir der Meinung, dass dieser Kritik nicht mit ähnlich plakativen Thesen begegnet werden kann. Nur durch einen offenen konstruktiven Dialog und ehrliche Angebote kann der Agrarsektor von seinen Leistungen überzeugen.
Kontakt
Dr. Horst-Henning Steinmann
Zentrum für Biodiversität und nachhaltige Landnutzung
Georg-August-Universität Göttingen
Mail: hsteinm@gwdg.de
Prof. Dr. Bärbel Gerowitt
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät – Phytomedizin
Universität Rostock
Mail: baerbel.gerowitt@uni-rostock.de
Quellen
[i] Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften (2020): Biodiversität und Management von Agrarlandschaften – Umfassendes Handeln ist jetzt wichtig. Halle (Saale)
[ii] Hallmann, C.A. et al., 2017: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10): e0185809.
[iii] Wissenschaftliche Dienste des Bundestages (2018): Zum Rückgang der Biomasse fliegender Insekten in Europa. AZ WD 8 – 3000 – 048/18.
[iv] Müller, J. et al. (2023): Weather explains the decline and rise of insect biomass over 34 years. Nature, 628, 349–354.
[v] Niggli, U., Riedel, J., Brühl, C., Liess, M., Schulz, R., Altenburger, A., Märländer, B., Bokelmann, W., Heß, J., Reineke, A., Gerowitt, B. (2020): Pflanzenschutz und Biodiversität in Agrarökosystemen. Ber. Landw. 98/1.
[vi] Wan, N.F. et al. (2025): Pesticides have negative effects on non-target organisms. Nature Communications volume 16, 1360.
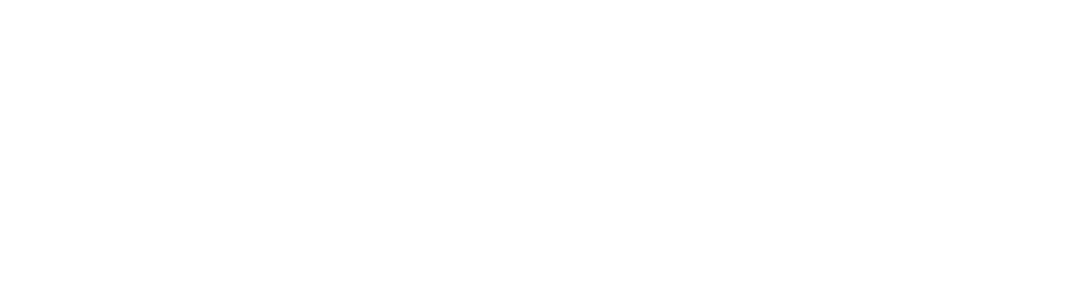

Ein mindestens genauso hoher Effekt kommt von den immer größeren Flächen mit fehlenden Strukturelementen. Aber was sollen die Landwirte bei dem enormen Kostendruck machen?
Politische Programme zur Förderung der Artenvielfalt haben das hohe Risiko, bei sich ändernden Mehrheiten in eine Sackgasse zu führen.
Landwirte sollten erkennen, das beispielsweise Strukturelemente, die zu einer Vernetzung noch verfügbarer Habitate beitragen können, die Resilienz der Agrarlandschaft verbessern und folglich ihre Anlage oder Schonung und Pflege im eigenen Interesse sind. Für den Berufsstand, der sich selbst als der Nachhaltigkeit verpflichtet sieht und dies de facto auch sein muss, da qualitativ hochwertige Ackerflächen begrenzt sind, kann das ausschließliche Interesse an kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteilen keine angemessene Perspektive darstellen.