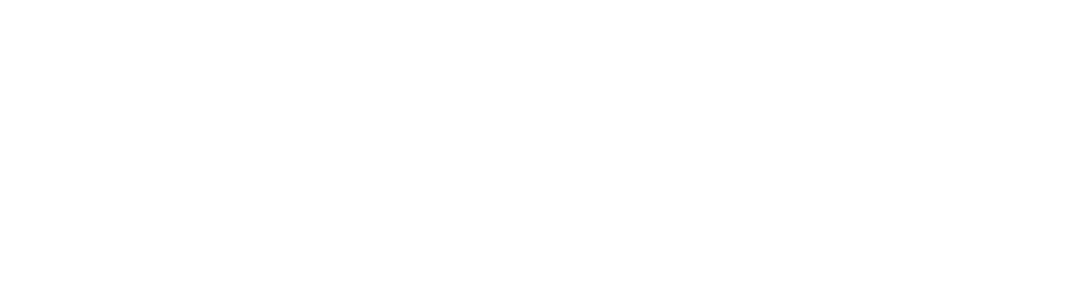Deutschland importiert jährlich über 3 Millionen Tonnen Sojabohnen – ein Großteil davon kommt nach Niedersachsen. Dabei verfügt das Bundesland über enormes Potenzial für den heimischen Anbau: Rund 71 Prozent der 1,9 Millionen Hektar niedersächsischer Ackerflächen wären grundsätzlich für Sojabohnen geeignet. Trotzdem wurden 2023 gerade einmal 1.536 Hektar mit der Eiweißpflanze bestellt, wovon 71,4 % ökologische angebaut wurden und der Rest konventionell. Warum bauen niedersächsische Landwirtinnen und Landwirte nicht mehr Sojabohnen an? Eine empirische Untersuchung von Thido Oldewurtel, Marius Michels, Hendrik Wever & Oliver Mußhoff der Georg-August Universität Göttingen liefert Antworten.
Eine Pflanze, drei Welten
Im Rahmen einer Studie wurden 28 Landwirtinnen und Landwirte aus Niedersachsen mit der sogenannten Q-Methode befragt – einem Verfahren, das subjektive Sichtweisen systematisch erfasst und gruppiert. Das Ergebnis zeigt eine bemerkenswerte Heterogenität: Drei klar unterscheidbare Perspektiven konnten identifiziert werden, denen sich 22 Befragte zuordnen ließen. Die verbleibenden Landwirtinnen und Landwirte konnten per Q-Methode keiner dieser Perspektiven zugeordnet werden, was nochmal unterstreicht, dass über die identifizierten Meinungsgruppen hinaus noch weitere Sichtweisen existieren.
Die erste Gruppe sieht vor allem Chancen. Acht von elf Landwirten in dieser Gruppe bauen bereits Sojabohnen an. Sie schätzen insbesondere den hohen Vorfruchtwert und die natürliche Stickstofffixierung der Pflanze. Die Landwirte berichten, dass der Sojaanbau in Kombination mit der Ökoregelung 2 „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ absolut konkurrenzfähig sei – insbesondere auf leichten Böden. Einige Landwirte organisieren sich bereits in Erzeugergemeinschaften, um Mengen zu bündeln und diese besser zu vermarkten. Insbesondere bei der Aussaat helfen der technische Fortschritt bei Einzelkornsägeräten einen gleichmäßigen Bestand durch homogenere Ablagetiefe zu erreichen.
Ganz anders sieht es bei der zweiten, allerdings sehr kleinen Gruppe bestehend aus zwei Landwirten aus. Hier werden vor allem Barrieren im Anbau von Sojabohnen in Niedersachsen gesehen. Die Landwirte aus den viehhaltungsintensiven Landkreisen Cloppenburg und Vechta stehen vor einem Dilemma: Ihre Betriebe produzieren große Mengen an Wirtschaftsdünger, die sie auf den Feldern ausbringen müssen. Da Sojabohnen aufgrund ihrer Stickstofffixierung keinen Düngebedarf laut Düngeverordnung (DüV) haben, entstehen hohe Kosten für die Abgabe überschüssiger Gülle. Des Weiteren sehen Landwirte in dieser Gruppe ein potenzielles Risiko durch erhöhten Unkrautdruck, wenn Sojabohnen in die Fruchtfolge mit aufgenommen werden. Ebenso sehen Vertreter dieser Gruppe ein arbeitswirtschaftliches Problem, da der Mais zum vergleichbaren Anbauzeitpunkt und zeitlich ähnlich gelagerten Pflegemaßnahmen bereits Arbeitsspitzen verursacht.
Die dritte Gruppe bestehend aus neun Landwirten nimmt eine Mittelposition ein. Diese Landwirte erkennen durchaus Potenzial, sehen aber aktuell zu viele Risiken. Ihre Hauptsorgen: schwierige Vermarktung, fehlende Erfassungsstellen und Wetterrisiken. Einige Landwirte berichten, dass der regionale Landhandel zum Beispiel keine Sojabohnen annimmt. Außerdem werden auch in dieser Gruppe die Sorgen der zweiten Gruppe bezüglich der Unkrautbekämpfung geteilt. Dennoch blicken viele optimistisch in die Zukunft: Der Klimawandel macht den Anbau langfristig möglich. Ebenso macht der hohe Vorfruchtwert die Sojabohnen attraktiv für die Zukunft.
Entscheidender als der Standort: Betriebsstruktur und Haltung
Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich: Ob Landwirte Sojabohnen anbauen, hängt nicht primär von Bodengüte oder Klima ab. Entscheidend sind vielmehr die betrieblichen Rahmenbedingungen und persönlichen Einstellungen. Während Betriebe mit hohem Viehbesatz durch die Düngeverordnung ausgebremst werden, fehlt reinen Ackerbaubetrieben oft die Vermarktungsinfrastruktur.
Besonders aufschlussreich ist der Blick auf die Risikobereitschaft: Die für den Sojabohnenanbau optimistisch gestimmten Landwirte schätzen sich deutlich risikobereiter ein als ihre sojaskeptischen Kollegen. Auch die Innovationsfreude beim Anbau neuer Kulturen unterscheidet sich erheblich zwischen den Gruppen.
Was bedeutet das für die Praxis?
Will man den Sojabohnenanbau in Niedersachsen voranbringen, braucht es differenzierte Ansätze. Pauschale Fördermaßnahmen greifen zu kurz. Für die bereits überzeugten Landwirte wären technische Verbesserungen wie spezielle Erntemaschinen hilfreich. Die Skeptiker benötigen dagegen vor allem bessere Vermarktungsstrukturen und Absatzsicherheit. Für Betriebe mit Wirtschaftsdüngerüberschuss bleibt der Sojabohnenanbau allerdings vorerst unattraktiv. Ohne alternative Verwertung des Wirtschaftsdüngers bleibt der Sojabohnenanbau gerade für die Betriebe mit potenzieller attraktiver innerbetrieblicher Verwertung unattraktiv.
Zukunft mit Fragezeichen
Die Studie macht eines klar: Das Potenzial für heimischen Sojabohnenanbau ist vorhanden, wird aber durch vielfältige Barrieren gehemmt. Ob der Sojabohnenanbau in Deutschland im Allgemeinen und in Niedersachsen im Speziellen perspektivisch vermehrt angebaut, hängt davon ab, wie gut es gelingt, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Landwirte einzugehen. Der Klimawandel könnte dabei zum unerwarteten „Unterstützer“ werden. Eines steht fest: Will Deutschland seine Importabhängigkeit bei Eiweißpflanzen reduzieren, führt kein Weg daran vorbei, die Einstellungen und Sichtweisen der Landwirte ernst zu nehmen. Denn sie entscheiden letztendlich, was auf den Äckern wächst.
Kontakt
Thido Oldewurtel, Marius Michels, Hendrik Wever, Oliver Mußhoff
Arbeitsbereich Landwirtschaftliche Betriebslehre
Georg-August-Universität Göttingen
https://www.uni-goettingen.de/de/18661.html