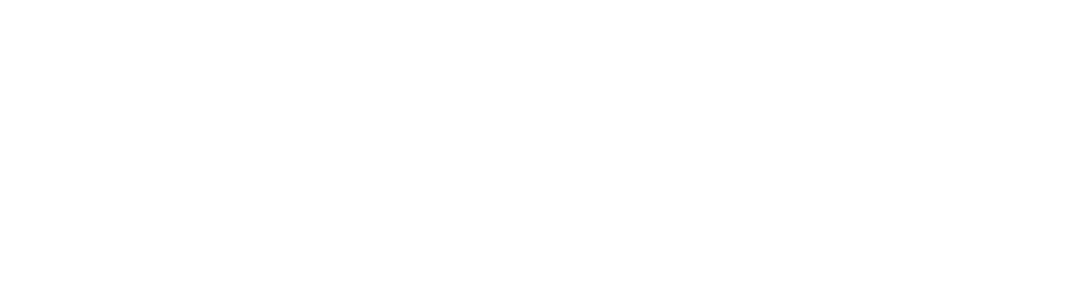Agriphotovoltaik-Forschungsanlage – Einweihung
Stromproduktion und Landwirtschaft auf einer gemeinsamen Fläche – als Teil einer nachhaltigen Energiewende: Das ist das Versprechen von Agriphotovoltaik. Tatsächlich kann sich der Schatten hochaufgeständerter Module sogar positiv auf die Ackerpflanzen auswirken und sie resilienter gegenüber Hitzestress und Dürreperioden machen. Forschende der Universität Hohenheim in Stuttgart erforschen dies künftig in einer 3.600 m² großen Forschungsanlage am Ihinger Hof in Renningen. Die Anlage ist Teil der Modellregion Agri-PV Baden-Württemberg und wird vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) finanziert. Medienvertreter:innen sind zur Einweihung mit Staatssekretärin Sabine Kurtz am 6. November um 12 Uhr herzlich eingeladen.
Genetische Vielfalt von Hafer entschlüsselt
Hafer ist eine wichtige Nutzpflanze mit vielen gesundheitlichen Vorteilen und vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Einem Forschungsverbund unter Beteiligung der Technischen Universität München (TUM) ist es gelungen, die Genome von 33 Hafersorten zu entschlüsseln, also deren komplette genetische Vielfalt abzubilden. Diese umfassende genetische Übersicht bietet Ansätze für die Zucht robuster, ertragreicher Pflanzen, denn auch Hafer gerät im voranschreitenden Klimawandel zunehmend unter Druck.
Moore unter Beobachtung
Moorböden sind für den Klimaschutz von zentraler Bedeutung: In ihnen ist, trotz deutlich geringerer Fläche, mehr Kohlenstoff gespeichert als in allen deutschen Wäldern zusammen. Mit dem Aufbau von 155 festen Messstationen in Offenland und Wald wurde in den vergangenen fünf Jahren ein einzigartiges Mess- und Informationsnetz geschaffen, das künftig die wissenschaftliche Grundlage für den Moorbodenschutz in Deutschland bildet. Den Bericht zur Aufbauphase des deutschlandweiten Moorbodenmonitoring für den Klimaschutz (MoMoK) nahm Staatssekretär Prof. Dr. Dr. Markus Schick im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) gestern von der Präsidentin des Thünen-Instituts, Frau Prof. Dr. Birgit Kleinschmit in Empfang.