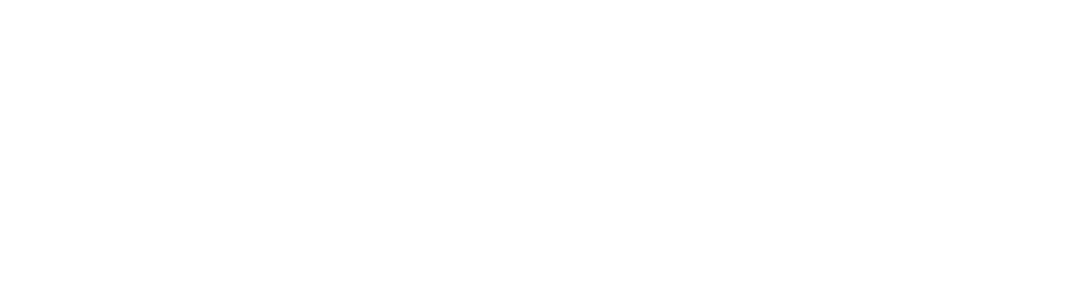Natürliche Abwehr: Wie ein Pflanzenhormon Fraßinsekten bekämpft
Wie alle Pflanzen können sich auch Tomatenpflanzen gegen Fraßinsekten wehren: Bei Verwundung durch Fressfeinde setzen sie das Signalpeptid Systemin frei, das im Zentrum der Abwehrmechanismen steht. Wie das Systemin-Signal in der Zelle verarbeitet wird, haben nun Forschende der Universität Hohenheim in Stuttgart aufgedeckt. Eine Schlüsselrolle spielt ein Enzym mit dem bemerkenswerten Namen „Poltergeist-like Phosphatase“ (PLL2). Es wird durch das Systemin-Signal aktiviert und ist für die Zielgenauigkeit der Abwehrreaktionen verantwortlich. Die Arbeiten wurden im Rahmen des SFB 1101 „Molekulare Kodierung von Spezifität in pflanzlichen Prozessen“ in Kooperation mit der Eberhard-Karls-Universität Tübingen durchgeführt. Nachzulesen sind die Ergebnisse dieser Grundlagenforschung in der Fachzeitschrift Nature Plants: www.nature.com/articles/s41477-025-02040-7.
Neue Ansätze für die Ernährung der Zukunft
Eine leichte Temperaturschwankung, ein abweichender pH-Wert oder etwas Feuchtigkeit – subtile Veränderungen und leichte Impulse reichen bereits aus, damit weiche Materie („Soft Matter“) ihre Struktur oder Funktion verändert. Ein Schlüsselprinzip dabei ist die molekulare Selbstorganisation: Winzige Bausteine auf Nano-Ebene – etwa Proteine oder Polymere – fügen sich von selbst zu geordneten Strukturen zusammen und passen sich somit flexibel an ihre Umwelt an.
Was zunächst abstrakt klingt, hat zahlreiche praktische Anwendungsfelder – von medizinischer Diagnostik über nachhaltige Wasseraufbereitung bis zur Entwicklung pflanzlicher Fleischalternativen. „An meinem Lehrstuhl entwickeln wir beispielsweise Biosensoren, die sehr gezielt an bestimmte Viren und Bakterienbestandteile andocken – und so sowohl Krankheiten als auch Verunreinigungen zuverlässig nachweisen können. Im Bereich der Umwelttechnik geht es unter anderem um Membrane, die Wasser von Salzen, Schadstoffen und Schwermetallen reinigen. Und an der Schnittstelle zur Lebensmitteltechnologie entstehen neue Ansätze für die Ernährung der Zukunft“, sagt Stefan Guldin.
Effiziente Schweinemast: Projekt EffiPig zeigt Wege zur Reduktion von Stickstoff und Phosphor
Wie lassen sich die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor in der Schweinemast reduzieren und gleichzeitig die Fütterung optimieren, ohne dabei Tiergesundheit oder Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen? Das Forschungsprojekt EffiPig unter Leitung des Instituts für Tierwissenschaften der Universität Bonn (ITW, Prof. Dr. Christine Große-Brinkhaus, Prof. Dr. Ernst Tholen) kommt zu dem Ergebnis: Eine stark stickstoff- und phosphorreduzierte (NP-reduzierte) Fütterung ist möglich, ohne gravierende Einbußen bei Tiergesundheit oder Leistung. Auf einem abschließenden Workshop in Kassel diskutierten Tierernährer und Tierzüchter praxisnahe Strategien zur weiteren Reduktion von Stickstoff- und Phosphorausscheidungen in der Schweinemast.