
Ein Beitrag von Prof. Dr. José Martinez
des Instituts für Landwirtschaftsrecht an der Universität Göttingen
„An einem Orte der Mancha, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will, lebte vor nicht langer Zeit ein Edelmann, einer von jenen, die einen Speer im Lanzengestell, ein altes Schild, einen hageren Gaul und einen Windhund zum Jagen haben.“ Mit diesem Satz eröffnet Miguel de Cervantes seinen Roman „Don Quijote de la Mancha“. Im Mittelpunkt dieses Werkes der Weltliteratur steht die Frage, was in unserer Umwelt Wirklichkeit oder Traum ist, also der Konflikt zwischen Realität und Ideal. Der Traum wird verkörpert von dem wundersamen Namensgeber des Romans, die Realität von einem kleinen, dicken, praktisch denkenden Bauern namens Sancho Panza. Er durchschaut die Narrheiten seines Herrn und versucht, ihn daran zu erinnern, dass die mächtigen Heere, von denen sie angegriffen werden, nur staubumwölkte Schafsherden sind und die bedrohlichen Riesen, denen sich Don Quijote tapfer stellt, einfach nur Windmühlen.
Die Zeitlosigkeit des Romans wird in dem Kampf gegen die Windmühlen deutlich, der sich heute im Kampf der Naturschützer gegen Windkraftanlagen oder Hochspannungsleitungen in Wäldern wiederholt. In einer Stellungnahme vom 13. Februar 2019 warnte die Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, Frau Prof. Dr. Beate Jessel, vor der Unverträglichkeit der Energiewende mit den Zielen des Umwelt- und Naturschutzes. Jedes vierte Windrad stünde bereits in Schutzgebieten; die künftige Planung von Windparks müsse auch stärker die Auswirkungen auf das „Landschaftsbild und Landschaftserleben“ berücksichtigen. Daher müssten naturnah wirkende Landschaften ohne technische Überprägung erhalten bleiben.“ Nur so könne man auf die notwendige Akzeptanz der Menschen vor Ort hoffen.
Die Akzeptanz von Landschaftsveränderungen durch die Gesellschaft ist jedoch nicht naturgegeben, sondern kulturhistorisch geprägt.
In der Tat dominiert in Deutschland eine konservative Sichtweise auf die Landschaft. Sie ist erheblich vom christlichen Humanismus der Herderschen Geschichtsphilosophie geprägt und wendet sich gegen eine Dominanz der Nutzungsorientierung. Landschaft wird als Kulturwert museal verstanden. Sie schafft Identifikationsräume für die Menschen, vorausgesetzt alles bleibt dort, wo es hingehört, und alles entwickelt sich gemäß seiner Eigenart – vom angeblichen „Urwald“ bis zur heimatlichen Heide. Dieser museale Blick auf die Landschaft ist eine Illusion, verkennt er doch, dass die Eigenart der Landschaften dynamisch geprägt ist. Dies wird am Beispiel der Industriekultur deutlich: rostende Stahlwerke und Bergbaubetriebe sind seit den 1990er Jahren als Bestandteil des Landschaftsbildes gesellschaftlich akzeptiert. Diese Industriestandorte, die durch ihre erheblichen Eingriffe in die Landschaft bis dahin noch als das Gegenteil von natürlicher Eigenart galten, werden seitdem nun selbst als Bestandteil einer neuen Form der Eigenart angesehen. Weil die Industrie durch den Strukturwandel obsolet geworden war, konnte die Gesellschaft zu den Industrieanlagen ein distanziertes, von Alltagszwängen entlastetes ästhetisches Verhältnis aufbauen. Das gilt auch für vermeintlich intakte Biotope, die ihre Entstehung erheblichen Eingriffen in den Naturhaushalt (wie zum Beispiel die Lüneburger Heide) oder Kriegen verdanken (wie zum Beispiel die Toskana). Insoweit mag unserer Generation noch das Windrad in der Landschaft fremd vorkommen. Für kommende Generationen wird es so selbstverständlich sein, wie es heute auch die Windmühlen in La Mancha sind.
-

Photo by Pixabay on Pexels.com
Zugleich ist die Gegenüberstellung Klimaschutz auf der einen und Naturschutz auf der anderen Seite eine Illusion. Klimaschutz ist eine zwingende Voraussetzung des Naturschutzes. Die bestehenden Biotope werden nur so lange fortbestehen können, wie die klimatischen Bedingungen es zulassen. Der naturschutzrechtliche Schutz von Feuchtgebieten hilft nicht, wenn Dürrephasen zur Regel werden. Artenschutz geht ins Leere, wenn der Lebensraum der Fauna und Flora sich klimabedingt verändert. Klimaschutz ist daher nachhaltiger Naturschutz. Windräder sind keine gegnerischen Riesen, gegen die der Naturschutz als „Ritter von der traurigen Gestalt“ kämpfen muss.
Der Naturschutz braucht daher (einmal wieder) den Realismus eines Bauern wie Sancho Panza, um nicht gegen die Evidenz der Strukturen eine Weltsicht zu entwickeln, die der faktischen Banalität der Wirklichkeit nicht angemessen ist.
Der Beitrag erschien in Erstpublikation in: AUR 2019, S. 81
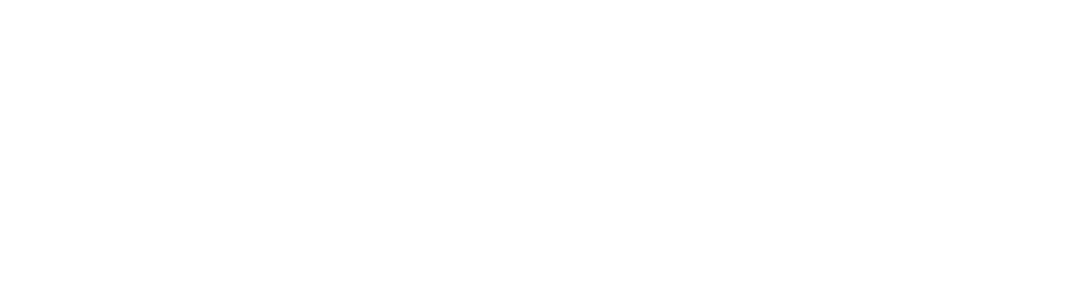

Keine Kommentare