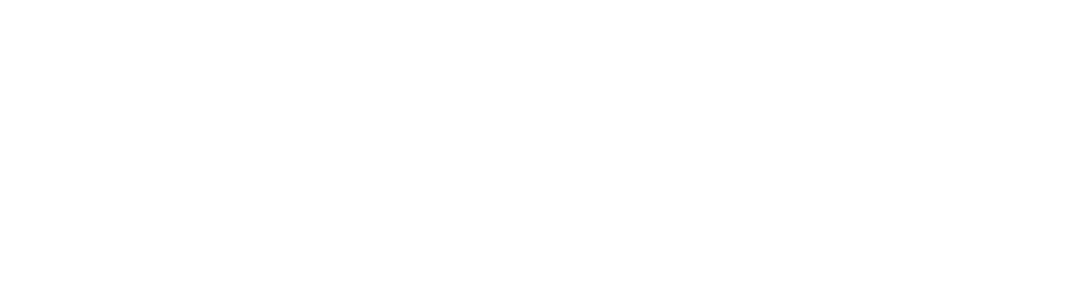– ein Beitrag von Prof. Dr. Achim Spiller (Lehrstuhl Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte, Georg-August-Universität Göttingen) & Dr. Anke Zühlsdorf (Zühlsdorf + Partner, Agentur für Verbraucherforschung und Lebensmittelmarketing)
In einem lesenswerten Artikel in der Rheinischen Post (Gruß an unsere alte Heimat, das Rheinland) stellt Jan Luhrenberg am 9. September die aktuelle politische Diskussion um ein Klimalabel vor (hier auch der Podcast dazu). Der Journalist greift hier die Sitzung des Bundestagspetitionsausschusses am 14. September und unseren Vorschlag für die Ausgestaltung eines Klimalabels auf, den wir in einem Beitrag auf AgrarDebatten vorgelegt haben. Unter anderem hat er Stellungnahmen von verschiedenen Institutionen und Politikern eingeholt. Im Folgenden gehen wir auf diese Argumente ein. Sie sind aus unserer Sicht zum Teil unbegründet, zum Teil greifen sie auch wichtige Herausforderungen auf, die aber lösbar sind.
Hier der Zeitungsbeitrag:

Unsere Position dazu:
(1) Klimalabel jetzt oder ein Gesamtumweltlabel irgendwann?
- BMEL: Kein Klimalabel, weil es nur einen Teil der Umweltprobleme aufgreift; es bedürfe einer Gesamtumweltbewertung entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
- Unsere Antwort: Ein Klimalabel betrachtet die gesamte Wertschöpfungskette – alles andere als eine solche Life Cycle-Perspektive wäre nicht state of the art. Richtig ist, dass der Treibhausgas (THG-)Ausstoß nur einen Teil der Umweltbelastung abbildet. Allerdings den umweltpolitisch heute wohl wichtigsten. Eine Gesamtbewertung aller Umweltparameter wäre super, scheitert aber heute an fehlenden Daten und noch mehr an der fehlenden Möglichkeit, die verschiedenen Umweltindikatoren (in Datenbanken wie ecoinvent sind es mehrere hundert) zu einer Maßgröße zu verdichten. Ohne diesen Bewertungsschritt kann eine komplette Ökobilanz nicht funktionieren. Die aggregierende Gesamtbewertung ist kein naturwissenschaftliches Problem, sondern eine normative (politische) Frage. Die Gesellschaft muss entscheiden, wie wichtig ihr Gewässerschutz, Biodiversität oder Klimaschutz im Vergleich sind. Um diese Aufgabe drückt sich die Politik in fast allen Ländern (Ausnahme: Schweiz) seit vielen Jahren. Dann ist es aber wohlfeil, eine Gesamtbewertung zu fordern, wohl wissend, dass das heute nicht seriös geht, und so die Konsument*innen im Regen stehen zu lassen.
(2) Wirklich zu aufwändig?
- Verbraucherzentrale Bundesverband: Klimalabel für Verbraucher*innen hilfreich für informierte Konsumentscheidungen, aber vielleicht doch zu aufwändig?
- Unsere Antwort: Der notwendige Aufwand zur Erhebung von THG-Emissionen entlang des gesamten Produktionsprozesses hängt stark von der Vorgehensweise und der gewünschten Präzision der Ergebnisse ab. Ein Extrem, das in den ersten Versuchen zu einem Klimalabel vor rund 10 Jahren angestrebt wurde, wäre, für jedes Unternehmen und jedes Produkt ganz spezifisch die THG-Emissionen zu erheben, also z. B. bei einer Molkerei bei allen landwirtschaftlichen Tierhaltern (mehreren Hundert, manchmal auch mehr als 1.000 Bauern), von jedem LKW usf. Dann wird es sehr teuer. Heute geht aber die Entwicklung in eine andere Richtung. Vieles spricht dafür, für den Liter Vollmilch im Tetra Pack zunächst mit einem Durchschnittswert zu starten. Dieser ist bekannt (siehe z. B. die Datenbank mit Sachbilanzen für die weltweite Nahrungsmittelproduktion und Ernährung von ESU-services oder Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland). In einem nächsten Schritt könnte der Wert mit einigen wichtigen, aber leicht messbaren Angaben präziser werden (z. B. Durchschnitts-Entfernung der Landwirte von der Molkerei, Auslastung der LKWs). Solche Angaben liegen in den Unternehmen regelmäßig vor. Eine THG-Bilanz auf dieser Basis kostet nur einige Hundert oder wenige Tausend Euro. Und schließlich steht es jedem Anbieter frei, für seine Produkte ganz präzise Werte zu erheben und diese Werte von neutraler Seite zertifizieren zu lassen, wenn er besser als der Durchschnitt ist. Er kann dann diese Daten auch als Werbeargument nutzen. Und noch etwas trägt zur wachsenden Praktikabilität bei: Einige Forschungsinstitute arbeiten derzeit intensiv an der weiteren Automatisierung der Berechnungen. Besonders weit fortgeschritten ist hier wohl Eaternity. Zusammen mit Codecheck, einer App, in der viele Tausend Lebensmittel mit ihren Zutaten erfasst sind, versucht Eaternity auf Basis der bekannten Zutaten und weiterer verfügbarer Informationen den THG-Ausstoß für zehntausende Lebensmittel IT-gestützt zu berechnen.
(3) Zu große Schwankungsbreite zwischen den Produkten?
- CDU/CSU: Die Schwankungsbreite zwischen der THG-Belastung verschiedener Produkte innerhalb einer Produktkategorie sei zu groß und verhindere eine seriöse Bewertung.
- Unsere Antwort: Es stimmt: Wenn man z. B. alle Tomaten „in einen Topf haut“, dann ist die Schwankungsbreite zu groß, da die verschiedenen Anbauformen (Freiland, unbeheiztes Gewächshaus, regenerativ beheiztes Gewächshaus, fossil beheiztes Gewächshaus) eine Varianz von mehreren hundert Prozent aufweisen. Offensichtlich würde man hier dem unterschiedlichen Produktionshintergrund nicht gerecht werden. Aber warum sollte man dies auch tun? Die vier angesprochenen Produktionsformen lassen sich klar voneinander differenzieren. Es sollte daher der Durchschnittswert für die jeweilige Produktionsform verwendet werden. Dann sinkt die Varianz der Werte sehr stark. Und ein Tomatenanbauer, der besondere Klimaanstrengungen in seiner Produktion unternimmt und dies durch eine eigene Berechnung nachweisen kann, soll in unserem Modell seinen besseren Wert auch labeln. Ähnlich geht man z. B. auch beim Ausweis der Nährwerte für ein Lebensmittels vor. Die Nährwertberechnung basiert auf Durchschnittswerten, die im Bundeslebensmittelschlüssel hinterlegt sind. Auch hier gibt es produktionsbedingte Schwankungen, die letztlich nicht im Detail in der Nährwerttabelle abgebildet werden. Damit wird deutlich, dass es eine nicht ganz triviale, aber doch lösbare Aufgabe ist, die Produktkategorien hinreichend differenziert festzulegen. Es wird aber auch deutlich, dass hier jemand die Spielregeln sinnvoll setzen muss. Es bedarf einer staatlichen Rahmensetzung für die sog. Product Category Rules.
(4) Reichen Bio-Siegel und Regionalfenster nicht aus?
- SPD: Es wäre zu prüfen, ob Biosiegel oder Regionalhinweise nicht ausreichen.
- Unsere Antwort: Biosiegel und Regionalität sind insgesamt wichtig, aber für den Klimaschutz schlechte Indikatoren. Stand der Forschung ist, dass der ökologische Landbau viele wichtige Umweltvorteile bringt, aber beim Klimaschutz im Durchschnitt nicht besser oder schlechter ist (WBAE 2020). So wird z. B. kein synthetischer Stickstoff eingesetzt, was gut für das Klima ist. Aber der Ertrag ist mindestens 20-30 % geringer, so dass auf das Produkt umgerechnet die CO2-Bilanz insgesamt ähnlich wie für konventionelle Produkte ausfällt. Regionalität allein ist ebenfalls kein guter Klimaindikator. Transportentfernungen haben häufig nur einen ziemlich geringen Anteil an dem gesamten THG-Ausstoß eines Lebensmittels. Klare Ausnahme: Bei Flugtransport ist die Klimabilanz ruinös, ein Klimalabel würde dies deutlich machen. Eine gute Klima-Faustregel ist regional in Kombination mit saisonal. Aber die Tomate aus der Region, im Frühjahr im beheizten Gewächshaus erzeugt, ist beim Klimaschutz bedeutend schlechter als die Freilandtomate aus Spanien. Und Bio und Regio sagen auch nichts über die Umweltfreundlichkeit der Verpackungen aus. Bio ist ein guter Hinweis auf eine insgesamt umweltfreundliche Form der Landwirtschaft, für Biodiversität und Co – und insofern auch kein Widerspruch zum Klimalabel. Beides kann sich gut ergänzen. Die vielen Biohersteller, die sich zum Beispiel um eine besonders klimafreundliche, ökologische Verpackung bemühen, werden dann auch gut beim Klimalabel abschneiden. Aber nicht jedes Bioprodukt ist klimafreundlich und umgekehrt gibt es auch klimafreundliche konventionelle Lebensmittel.
(5) Ersatz für andere Instrumente? Wir plädieren für einen Instrumenten-Mix
- Parteien Grüne und Linke: Klimalabel darf nicht als Ersatz für andere Instrumente dienen und wirksamere Instrumente verhindern.
- Unsere Antwort: Stand der Forschung zu ernährungspolitischen Instrumenten ist es, dass alle Instrumente für sich alleine nur begrenzte Beiträge für einen nachhaltigeren Konsum bringen. Auch eine Klimasteuer auf Fleisch verringert den Konsum bei realistischen Steuersätzen nur begrenzt. So würde eine Streichung der Mehrwertsteuersubvention und damit die Verwendung des Normalsatzes von 19 % statt 7 % den Konsum nur um ca. 3-4 % verringern. Vielmehr gibt es eine zunehmende wissenschaftliche Evidenz für die Sinnhaftigkeit eines Instrumenten-Mixes. Klimalabel, Lenkungssteuern, Nudging usf. haben in der Regel synergistische Effekte, daher sollten sie nicht gegeneinander ausgespielt werden.
(6) Lieber freiwillig? Oder warum der Staat den Rahmen setzen muss
- FDP: Ein freiwilliges Label wäre die bessere Alternative, auch weil ein verpflichtendes Label EU-rechtlich wahrscheinlich nicht geht.
- Unsere Antwort: Ein verpflichtendes Label würde eindeutig größere Wirkungen im Markt erzielen, da diese vollständige Transparenz über alle Produkte eine bessere Vergleichbarkeit ermöglicht und weil gerade die schlechteren Bewertungen von den Verbraucher*innen stärker beachtet werden. Aber genau aus diesem Grund werden die Hersteller freiwillig in aller Regel nur die gut abschneidenden Produkte labeln. Ist ein verpflichtendes Label juristisch zulässig? Unstrittig auf EU-Ebene. National schwieriger, aber nicht unmöglich. So könnte Deutschland zumindest alle nationalen Anbieter zur Kennzeichnung verpflichten, die sog. Inländerdiskriminierung. Diese ist EU-rechtlich zulässig. Die bei weitem meisten Lebensmittel wären dann erfasst und vielleicht würde der Lebensmittelhandel mit seiner Marktmacht dafür sorgen, dass auch das eine oder andere Importprodukt das Klimalabel tragen würde. Ohne einzelne Länder, die ein Label zunächst national einführen (ob freiwillig oder verbindlich), ist es übrigens auf EU-Ebene noch nie zu einem neuen Label gekommen. Immer sind einzelne Länder hier vorangeschritten, wie z. B. Frankreich beim Nutri-Score. Und wer hier vorlegt, hat gute Chancen, die Standards zu bestimmen.
Unsere Kernaussage ist nicht, dass bereits alle Herausforderungen beim Design eines Klimalabels gelöst sind. In unserem ersten Beitrag ging es uns genau darum, die noch zu klärenden Fragen anzusprechen. Diese Fragen lösen sich aber nicht von alleine, zumeist geht es um Konventionen. Bei der Klimabilanzierung ist es nicht anders als bei der kaufmännischen Bilanzierung: Es müssen Regelungen zur Bilanzierung festgelegt werden – eine Tätigkeit, für die es allein in Deutschland wohl gut 100 Professuren für Wirtschaftsprüfung und Bilanzierung gibt. Wo ist wenigstens eine kleine Arbeitsgruppe, die die Regierung zum Thema „Entwicklung der Regelungen für die Messung von Treibausgasemissionen von Produkten“ einsetzt? Die Unternehmen starten jetzt zunehmend mit eigenen Labeln, jeder nach seinem Konzept. Um weitere Verbraucherverwirrung im Labeldschungel gar nicht erst entstehen zu lassen, ist eine Standardisierung wesentlicher Kriterien dringend erforderlich.
Literatur:
Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE) (2020): Politik für eine nachhaltigere Ernährung, Gutachten, Berlin